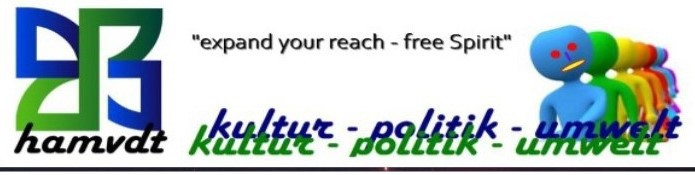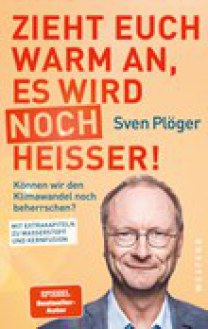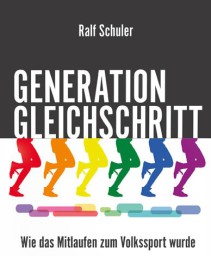Ein Besuch in Berlins Konsumtempel KaDeWe: „Es wäre ein furchtbarer und tragischer Verlust“
Eine Flasche Wein für 32.000 Euro: Das KaDeWe ist ein Kultkaufhaus, das dem Luxus huldigt – und das zu Berlin gehört wie das
Brandenburger Tor. Ein Besuch in Deutschlands wohl bekanntestem Kaufhaus, auf dessen Überleben Kunden wie Verkäufer hoffen. Ein Besuch in Deutschlands wohl bekanntestem Kaufhaus, auf dessen Überleben
Kunden wie Verkäufer hoffen.
In der Weinabteilung des KaDeWe ist von einer Krise nichts zu spüren. Der teuerste Wein hier ist ein Chateau Mouton Rothschild aus
dem Jahr 2000 für 32.000 Euro. Immerhin kommt der edle Tropfen in einer limitierten Fünfliterflasche, von diesem Wein gibt es in ganz Deutschland nur drei Stück. Kürzlich habe er einen anderen Wein
für 25.000 Euro an einen Kunden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft, sagt ein Mitarbeiter. Auch reiche Chinesen deckten sich hier ein, seit dem Ukraine-Krieg blieben nur die Russen
aus.
Das Handelsunternehmen KaDeWe Group betreibt neben dem gleichnamigen Berliner Luxuskaufhaus auch das Oberpollinger in München und das
Alsterhaus in Hamburg – nun hat der Konzern Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, teilte die KaDeWe Group mit. In Berlin sorgen bei Passanten
am Montag rote Poster an der Fassade von Deutschlands wohl bekanntestem Kaufhaus für Verwirrung, die einen „Final Sale“ mit Rabatten bis zu 60 Prozent anpreisen. „Kann man sich gar nicht vorstellen,
dass so eine Riesenklamotte pleitegeht“, sagt ein älterer Mann zu seiner Ehefrau.
Insolvenz trübt Stimmung der Belegschaft nicht
Eine Verkäuferin – sie will keinen Namen nennen – klärt auf Nachfrage auf, dass die „Final Sale“-Poster nichts mit einem etwaigen Finale
des KaDeWe zu tun hätten. „Die hängen schon länger da.“ Es handele sich um eine gewöhnliche Rabattaktion. Über eine mögliche Insolvenz wisse die Belegschaft nicht mehr, als die Medien berichteten.
„Wir machen uns jetzt erst mal nicht verrückt.“ Ihren Kollegen fragt sie: „Die Stimmung bei uns ist gut, oder?“ Der Verkäufer nickt. Das Kaufhaus des Westens öffnete am 27. März 1907 seine Pforten,knapp 117 Jahre später ist es eine Institution, die
zu Berlin gehört wie das Brandenburger Tor. Nach Angaben des Unternehmens kommen täglich mehr als 50.000 Kunden. Man muss schon ein eingefleischter Anhänger von Planwirtschaft sein, um der
Faszination des glitzernden Konsumtempels nicht zu erliegen.
Im Erdgeschoss finden sich Parfüms und Kosmetikartikel von Chanel, Gucci und Hermès. Im Rolex-Schaufenster ist die günstigste Uhr für
5700 Euro zu haben. Bei der Herrenkleidung im ersten Obergeschoss liegt eine Baseballkappe für 350 Euro aus. Bei den Frauen im Stock darüber ginge das grüne Abendkleid für 1600 Euro über den Tresen.
Im dritten Stock gibt es unter anderem Dessous aus Paris, wer die Rolltreppe nach oben nimmt, kommt zur Bücherabteilung. Im Regal stehen Werke mit Titeln wie diese: „Ein Mann und seine Uhr“, „Vom
nützlichen Luxus“ oder „Die Zukunft des Luxus“.
„Ich glaube, das KaDeWe wird es immer geben“
Der Verkäufer in der Weinabteilung ist sich sicher, dass der Luxus des KaDeWe eine Zukunft haben wird. Er hat 1991 im KaDeWe seine
kaufmännische Lehre begonnen, während des Studiums dort gejobbt und danach dort seinen Job angefangen. „Das KaDeWe ist einmalig, es ist ein Kultkaufhaus“, sagt er. „Unser Geschäft läuft immer. Ich
glaube, das KaDeWe wird es immer geben.“ Im fünften Stock sind ein Formel-Eins-Rennwagen und ein von Michael Schuhmacher signierter Helm ausgestellt. Dort gibt es High-End-Lautsprecher und edles
Schreibgerät. Ein lila-gelbes Feuerzeug ist für 1390 Euro zu haben, der farblich dazu passende Aschenbecher für 445 Euro. Die Ausbuchtungen im Ascher sind nicht für schnöde Zigaretten, sondern für
fette Zigarren gemacht.
Jede Menge Köstlichkeiten aus aller Welt
Das kulinarische Paradies findet sich im sechsten Stock, das Angebot ist unglaublich vielfältig, oftmals exotisch und schlicht umwerfend.
Es gibt Schinken aus Spanien, Gewürzpaste aus Japan, französische Schokolade in Sardinenform. In einem Regal stehen mehr als 100 unterschiedliche Dosen mit Fisch und anderen Meeresfrüchten. In einer
Theke daneben liegt Beluga-Kaviar aus, 50 Gramm für 298 Euro. Der Dijon-Senf für 3,49 Euro ist zwar nichts Besonderes, und beim Discounter kostet er nur 1,99 Euro. Dafür kann der Discounter zum
Beispiel nicht mit Bienen aufwarten: Im KaDeWe angesiedelte
Honigbienenvölker sammeln Nektar und Blütenpollen in Berliner Parks und Gärten, aus denen dann der hauseigene Honig gemacht wird, der hier – natürlich –
als „Flüssiges Gold“ vermarktet wird.
„Wenn man kein Geld ausgeben will, dann darf man nicht hierherkommen“
Aylin Ürkmez und Maximilian Stapper (beide 30) aus Paderborn schlendern durch die Stände mit ihren vielen Verlockungen. „Wir sind
Feinkostmenschen“, sagt Ürkmez. Wann immer sie in Berlin sind, besuchen sie das KaDeWe, sie schätzen das edle Ambiente. Sollte das Kaufhaus schließen müssen, „dann ginge ein Stück Geschichte
verloren“, sagt Ürkmez. „Unsere Reisen wären ärmer.“
eingestellt von HAM am 30.01.2024
Die Signa-Holding von René Benko sowie zahlreiche Tochterfirmen sind insolvent. Zum Imperium des Immobilien-Tycoons gehören
Luxushotels, Kaufhäuser und weitere Prestige-Objekte. Was wird aus Galeria, KaDeWe, SportScheck und Co?
Ende November 2023 hat die Signa Holding Insolvenz angemeldet, seitdem zerbröckelt das Imperium des österreichischen Milliardärs René
Benko immer weiter. Neben der Muttergesellschaft des Immobilien- und Handelskonzerns haben auch zahlreiche Tochterfirmen und deren Beteiligungen Insolvenz angemeldet. Die Zukunft der insolventen
Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, der Signa-Beteiligung KaDeWe und weiterer Unternehmungen ist ungewiss. Auch SportScheck musste kurz vor einem geplanten Verkauf Insolvenz
anmelden.
In Deutschland ist Benko vor allem durch die Übernahme der Galeria-Kaufhauskette bekannt geworden. Im Kern ist Benko aber ein
Immobilieninvestor, der bei zahlreichen Großprojekten mitmischte. Vor allem die gestiegenen Zinsen sorgten im vergangenen Jahr dafür, dass viele Rechnungen nicht mehr aufgingen und sich die
Liquiditätsprobleme bei Signa zuspitzten.
Und nun eine rollende Galerie der Sahne-Stücke aus der Benko - Insolvenz mit Baustelle Elb-Tower, Alsterhaus, KA DE WE und
mehr...
Benkos Geheimgeschäfte: Signa zahlte offenbar heimlich bar Millionen-Dividenden an Kühne und RAG-Stiftung.
René Benko gibt dieser Tage nicht auf. Der Signa-Gründer soll sich aktuell im österreichischen Innsbruck aufhalten und immer noch von morgens bis nachts Investoren suchen, die rettende
Millionen zuschießen sollen in sein implodierenden Immobilien- und Handelskonzern. Das berichten mehrere Personen unabhängig voneinander, die dem Milliardär nahestehen.
Die Suche nach neuen Geldgebern wird sich womöglich schwierig gestalten, langsam kommen nämlich immer mehr geheime Geschäfte des
Milliardärs bei der Signa-Holding ans Licht, die kein gutes Licht auf Benkos Umgang mit Investoren wirft. Unsere Recherchen zeigen, dass der österreichische Milliardär im vergangenen Jahr über die
Signa Prime eine Dividende an den Milliardär Klaus Michael Kühne und die RAG-Stiftung ausgeschüttet haben soll für das Jahr 2022. Die RAG-Stiftung hält fünf Prozent an der Signa Prime, die
Kühne-Holding hält zehn Prozent.
Bei der Ausschüttung soll es sich um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Brisant: Die Dividende soll einzig an diese
beiden Adressen geflossen sein, nicht an andere Gesellschafter und Aktionäre der Signa Prime. In dem Jahr gab es auch keine Dividende für Anteilseigner der Signa Holding. Die Gesellschafter hatten
von der geheimen Ausschüttung bis vor Kurzem keinerlei Kenntnis.
Kühne soll Druck ausgeübt haben
Die Dividendenausschüttung soll dabei auch auf Druck von Kühne erfolgt sein. Sie kam zu einer Zeit, in der sich die Geschäftsaussichten
für die Signa-Holding und die Tochtergesellschaften stark verdüstert haben.
eingestellt von Herbert Meyer am 03.02.2024
"Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, das mit Worten beginnt.
Ich tauschte eine Kamera als Werkzeug in Worte ein. So wird die Technologie zu meinem Partner, zu einem Medium, das meine bildnerische
Vision verstärkt. Das Erleben, dass die KI nicht nur Pixel, sondern auch meine Emotionen und Bedeutungen umwandeln kann ist KI."
Herbert A. Meyer 03.02.2024
Klimaneutrales Europa 2050
Max Mustermann im Elektrobus auf dem Weg zur Arbeit in das große Chemiewerk am
Rande der Stadt. Immerhin 20 Prozent der Beschäftigten konnten bleiben. Sie produzieren chemische Grundstoffe jetzt klimaneutral mit grünem Wasserstoff. Alles andere lässt der Konzern aus
Kostengründen und der in der EU zu starken Wasserstoffregulierung an anderen Konzernstandorten der Welt herstellen – dort auch ohne Chemikalienverordnung (Reach). Traurig blickt Max aus dem
Fenster. 25 Prozent Arbeitslosigkeit in der Region sind zu viel.
Und dann kommt noch rechts das Fabrikgelände einer ehemaligen Verzinkerei. Grün überwuchert, aber immerhin hat es das ehemalige
Familienunternehmen noch geschafft, ein kleines Industriemuseum „Haus der Verzinkerei-Geschichte“ für die Nachwelt zu erhalten.
Kreativ erhalten blieb auch die benachbarte ehemalige Großgärtnerei. Heute mit einer Demonstrationsanlage für den Treibhauseffekt – im
ehemals größten Gewächshaus der Region. Max war einmal da und hörte die Geschichte, dass Energie schlicht unbezahlbar war, Blackouts die Pflanzen vernichteten und Brüsseler Regulierung ein Problem
damit hatte, dass mithelfende Familienangehörige nach Geschlechtern unterschiedlich entlohnt wurden, obwohl das im kleinen Betrieb doch alles freiwillig und pragmatisch geregelt
war.
Ist den Menschen, vor allem aber der Politik noch bewusst, dass die Exporte der Industrie zu etwa 50 Prozent unseren Wohlstand und damit
überhaupt die Grundlage unserer sozialen Errungenschaften verantworten? Wohl kaum, denn die Industrie wird derzeit auf dem Altar eines zunehmend radikalen Klimaschutzes geopfert.
Etwa wenn eine Landesregierung bei Abiturarbeiten die Untergangsszenarien einer Luisa Neubauer als Thema vorgibt, aber Deutschlands
Vorreiterrolle im Klimaschutz keine Erwähnung findet. Wer sieht den Zusammenhang zwischen industrieller Innovationsführerschaft und sozialen Errungenschaften, wenn politisierte Kirchen selbst extremste
„Klimaprognosen“ der „Letzten Generation“ für bare Münze nehmen und Katastrophenszenarien ausmalen, die Angst machen? Politik und Kirche sollten der
Jugend Angst nehmen und nicht Angst machen.
Anreize statt Zwang. Mut machen statt Angst machen. Gerade in Deutschland gelingt es doch in den letzten Jahrzehnten vorbildlich,
Wirtschaftswachstum und CO2-Anstieg zu entkoppeln. Unser Land ist bei den Patentanmeldungen nach den USA immer noch Vizeweltmeister. Bei den Wasserstoff-Patenten rund um diesen Energieträger der
Zukunft ist Deutschland mit 11 Prozent sogar Weltmeister. Mit den dabei global führenden Regionen München und Ruhrgebiet. Das macht Mut.
Max Mustermanns Traurigkeit 2050 ist Utopie. Denn seinen Eltern ist es noch gelungen, die Weichen so zu stellen, dass Deutschland 2050
moderner Industriestandort und kein Industriemuseum ist. Und im Gewächshaus der Gärtnerei werden schönste Sommerblumen verkauft und nicht die Verfehlungen letzter Generationen
beklagt.
eingestellt von HAM am 11.07.2023
Was haben die GegnerInnen einer Vergesellschaftung der großen privaten Immobilienkonzerne, allen voran aus SPD und CDU, nicht alles an
Argumenten gegen die Umsetzung des Berliner Volksentscheids "Deutsche Wohnen
& Co enteignen" ins Feld geführt: Eine Vergesellschaftung verstoße gegen das Grundgesetz und würde Berlin finanziell ruinieren. Die Enteignungsgrenze,
wonach nur Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in der Stadt betroffen sein sollen, sei nicht haltbar, auch gemeinwohlorientierte Akteure wie Genossenschaften wären betroffen. Oder,
grundsätzlicher: Nur Neubau könne den angespannten Wohnungsmarkt der Stadt entlasten. All diese Scheinargumente hat die vor einem Jahr vom rot-rot-grünen Vorgängersenat eingesetzte
ExpertInnenkommission nun vom Tisch gefegt. In ihrem Abschlussbericht, der am Mittwoch dem CDU/SPD-Senat übergeben werden soll, stellen die ExpertInnen in beeindruckender Klarheit fest:
Das Grundgesetz, also der Vergesellschaftungs- artikel 15, gilt – auch in Berlin. Mit einem einfachen Vergesellschaftungsgesetz kann Berlin die
Überführung der Bestände von mehr als einem Dutzend privater Konzerne – insgesamt etwa 240.000 Wohnungen – in Gemeineigentum regeln, selbstverständlich gegen Entschädigung. Die allerdings
würde die Stadt nicht ruinieren, denn gezahlt werden müsste nicht der aktuelle Marktpreis. Die Maßnahme käme die Stadt also deutlich günstiger als die aktuelle Ankaufpolitik. Die Kommission sagt gar:
Es gibt kein mildes Mittel, wenn man dauerhaft leistbare Mieten für einkommensschwächere Schichten garantieren will. Auch mehr Neubau stelle keine Alternative dar, um eine dauerhafte Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum zu erreichen. Der Senat ist damit also in seiner letztlich rein ideologischen Ablehnung der Vergesellschaftung entlarvt – und steht nackt dar. „Wer enteignet, kündigt den
Grundkonsens der sozialen Marktwirtschaft auf“, hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) einst gewarnt. Doch das Gegenteil ist richtig: Eine Vergesellschaftung dient dem Erhalt des
gesellschaftlichen Friedens in einer Stadt, die Würde und Rechte auch aller einkommensschwächerer MieterInnen verteidigen muss. Nur durch sie kann der absehbaren Entwicklung hin zu einer Spaltung
in eine Innenstadt der Reichen und
Armutssiedlungen am Stadtrand entgegengewirkt werden. Und, nicht zu vergessen: Sie ist ein Gebot der Demokratie: Eine deutliche Mehrheit der BerlinerInnen hat sich für die Vergesellschaftung
ausgesprochen. Das gegen alle Argumente zu negieren, darf sich eine Regierung nicht erlauben.
in Anlehnung an einem taz Artikel
bearbeitet und eingestellt am 28.06.2023 von HAM